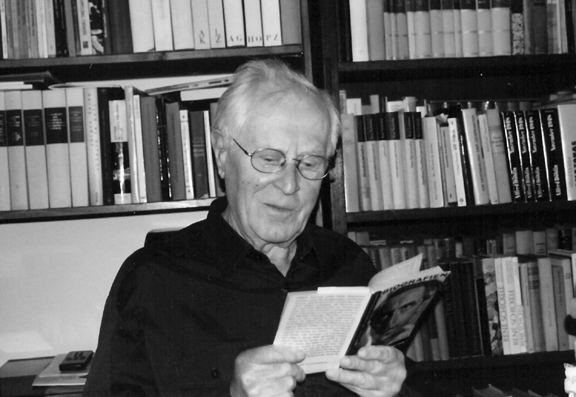
Kurt Wafner 2001

Antifa-Jugend 1935.
Kurt Wafner sitzt in der Mitte

Buchpremiere für
die Herausgabe der Programm-Zeitschrift „Schall undRauch“
im Foyer der Kammerspiele – mit Verlagsleiter Dr. Werner
Tenzle
|
Zum
Tod von Kurt Wafner (25.11.1918 – 10.3.2007)
Ein Nachruf
„Das wahre Heldentum liegt nicht
im Morden, sondern in der Weigerung, den Mord zu begehen.“
Nach dieser Maxime des pazifistischen Anarchisten Ernst Friedrich,
neben Erich Mühsam eines seiner Vorbilder, hatte Kurt
Wafner zu leben versucht.
Er hat es geschafft, obwohl bei seiner Beteiligung als Landser
am Zweiten Weltkrieg nicht viel gefehlt hätte, und er
hätte sich aktiv am Morden beteiligen müssen. Doch
seine Sozialisation im anarchistischen Jugendgruppen-Milieu
der zwanziger Jahre hatte Kurt Wafner zum bewussten Außenseiter
werden lassen, der auch in schlimmsten Lebenssituationen,
von denen er viele durchmachen musste, nach Wegen suchte,
um seine Menschlichkeit nicht zu verlieren. Später, in
den neunziger Jahren wurde der Kriegsteilnehmer zu einem der
Zeitzeugen bei der Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen
der Wehrmacht 1941-44“, zu der er auch eigene, während
der Kriegszeit gemachte Fotos beisteuerte.
In einem seiner Artikel, die er zu jener Zeit für die
Graswurzelrevolution schrieb, fasste er sein Bemühen,
bei der Rehabilitierung von Wehrmachtsdeserteuren mitzuhelfen,
zusammen:
„Für die aufmerksamen Betrachter bieten die hier
ausgebreiteten Dokumentationen noch tiefere Einsichten: Jede
Auseinandersetzung mit Waffengewalt erzeugt menschliches Leid
– Tod und Vernichtung. Darum dient sie niemals dem Volk,
sondern stets einer Prestige und Profit gewinnenden Oberschicht.
Und jeder Dienst mit der Waffe in einer Staats-Armee hilft
die Kriegsgefahr zu vergrößern, anstatt sie abzubauen.“
(Kurt Wafner: Ausgeschert
aus Reih' und Glied. Mein Leben als Bücherfreund
und Anarchist, Edition AV, Frankfurt/M. 2001, S. 186, alle
weiteren Zitate ebenfalls aus dieser Autobiographie.) Insofern
sprach Kurt Wafner auch von seiner eigenen Mitschuld, ohne
je im Weltkrieg auf den Feind geschossen zu haben... Und genau
darin, in dieser Ehrlichkeit, nichts vertuschen zu wollen,
liegt für mich ein Großteil seines Vermächtnisses
auch für die libertär-gewaltfreie Bewegung.
Das Revolutionskind
Kurt Wafner wurde im November 1918 mitten in der Berliner
Novemberrevolution geboren.
Im März 1919 rückten Freikorpstruppen in der Frankfurter
Straße vor, wo das Wohnhaus der Eltern und Großeltern
Kurts stand. Mehrfach ließ Noske dort und in angrenzenden
Straßen streikende ArbeiterInnen hinrichten –
ein Menetekel für das, was Kurt als Erwachsener noch
mit eigenen Augen sehen sollte. Auf Umwegen zog die Familie
bald nach Berlin-Weißensee.
Nach dem frühen Tod seines Vaters holte die Revolution
Kurt ganz privat ein:
„Aber eines Tages brach eine Revolution in unseren Alltag
herein. Bernard zog zu uns, mein Onkel, der jüngste Bruder
meines verstorbenen Vaters. Er wurde Mutters Lebensgefährte.
Bernard nannte sich Weltbürger, Vagabund, Anarchist.
Er war schon in verschiedenen Ländern umhergezogen und
brachte eine frische Brise in unsere abgeschiedene Welt –
die Freude am freien Denken, am aufrechten Gang. Und den Hass
auf Krieg und Gewalt.“ (S. 24)
Mit Hilfe des 1938 nach Argentinien ausgewanderten Bernard
entdeckte Kurt zwei Leidenschaften: die für den Anarchismus
und die für Bücher. Er wurde später auch Zeitzeuge
der Bücherverbrennung. Bücher begleiteten ihn sein
ganzes Leben.
Für seine geistige Entwicklung profitierte Kurt von der
Weißenseer weltlichen Reformschule, in der er Interesse
an allen Formen der Kunst entwickelte, seien es Theater, Chorgesang,
Malerei, Musik usw. Mit zehn Jahren bekam Kurt von Bernard
das aufwühlende Antikriegsbuch von Ernst Friedrich, Krieg
dem Kriege, in die Hand. Er begegnete Ernst Friedrich in dessen
1925 eröffneten Berliner Antikriegs-Museum.
„Ernst Friedrich wurde einer meiner wichtigsten Wegbereiter.
An die erschütternden Bilder in Buch und Museum dachte
ich oft, als ich die Schrecken des Krieges selbst erleiden
musste. Und ich fragte mich so manches Mal: Warum waren die
leidenschaftlichen Rufe dieses Rebellen und seiner Getreuen
ungehört verhallt?“ (S. 45)
Bernard nahm Kurt auch zu Treffen der „Anarchistischen
Vereinigung Weißensee“ mit, wo sich wöchentlich
rund 20-25 Aktive trafen. Über die Weißenseer Gruppe
lernte Kurt Erich Mühsam kennen:
„Die Persönlichkeit Erich Mühsams nahm eine
großen Raum in meinem Leben ein. Ich war stolz, als
es einige Male zu persönlichen Gesprächen kam. Ich
erinnere mich an eine Begegnung mit ihm in der Geschäftskommission
(GK) der FAUD (Freie Arbeiter-Union Deutschlands; d.A.), die
sich am Märkischen Ufer befand. (...) Mühsam, der
dort einige Male mit Rudolf Rocker, dem Kopf der anarchosyndikalistischen
Bewegung zusammentraf, sprach mich an. (...) Er wollte wissen,
was ich las. Als ich ihm Autoren wie Mark Twain, Jack London,
Zola und Traven nannte, war er sichtlich zufrieden. Er wollte
gehen, doch dann wandte er sich noch einmal um und sagte:
'Vergiß Goethe nicht! Und Heine! ... Die sind wichtig!’
Dass er mir ‚bürgerliche’ Literatur empfahl,
verstand ich damals nicht so ganz (...). Später beschäftigte
ich mich ausführlicher mit Mühsams Kunstkonzept.
(...) Es sei ‚lächerlicher Unfug’, von proletarischer
Kunst zu reden. 'Kunst soll begeistern’, schrieb er.“
(S. 50)
In den letzten Jahren der Weimarer Republik nahm Kurt am kulturellen
Leben der anarchistisch¬en Szene in Berlin teil.
Nach einem Vortragsabend mit Erich Mühsam beteiligte
er sich nach Ansprache von zwei Freunden an der Gruppe „Freie
Arbeiter-Jugend“ (FAJ). Zu deren Aktivitäten zählten
Ausflüge in die Berliner Umgebung, bevorzugt zum Hönower
Badesee, wo sich Jugendliche aus der Lebensreformbewegung
trafen, Lagerfeuerromantik erlebten, Antikriegslieder sangen,
über freie Liebe diskutierten und der in der anarchistischen
Jugendbewegung damals verbreiteten Freikörperkultur (FKK)
frönten – und wo Kurt einige frühe Liebesabenteuer
hatte.
Das war schon Anfang der dreißiger Jahre. Gegen den
aufkommenden Antisemitismus war Kurt resistent. Das hatte
auch damit zu tun, dass das jüdische Ehepaar Else und
Leib Bubis in die Wohnung der Wafners als UntermieterInnen
einzog.
Leib Bubis las den Wafners an Familienabenden Werke jüdischer
SchriftstellerInnen vor und wanderte mit Kurt zusammen über
den jüdischen Friedhof.
Er war ein Onkel von Ignatz Bubis, dem 1999 verstorbenen ehemaligen
Vorsitzenden des Zentralrats der Juden Deutschlands. Ignatz
fand das erst 1996 durch Zufall heraus, besuchte dann Kurt
– und daraus entwickelte sich eine freundschaftliche
Beziehung. Als mich Kurt Wafner kurze Zeit später für
einige Tage im Redaktionsbüro der damaligen Süd-Redaktion
der GWR besuchte, erzählte er mir ganz begeistert von
dieser Freundschaft. Ignatz Bubis lud ihn, seine Ehefrau Ingrid
und seine Enkelin Nadja sogar noch zu einer Reise nach Israel
ein.
Gratwanderungen im Nationalsozialismus
Noch kurz vor der Regierungsübernahme der Nazis nahm
Erich Mühsam mehrfach an den Gruppenabenden der FAJ teil.
Es traf die Gruppe umso härter, als sie erfuhr, dass
Mühsam 1933 von den Nazis verhaftet und 1934 im KZ Oranienburg
zu Tode gefoltertworden war. Die Bücher kritischer und
anarchistischer AutorInnen im Hause Wafner wurden aus Angst
entweder selbst verbrannt, mussten in einen Verschlag in den
Keller oder wurden an geheimen Stellen im Boden vergraben,
so etwa die Programmhefte des Kabaretts „Schall und
Rauch“ von Max Reinhardt, die Kurt in den 80er Jahren
über einen westdeutschen Verleger als Reprint wieder
veröffentlichte.
„Wir protestierten mit kleinen Schritten – aber
auch sie wurden zunehmend gefährlicher – bald schon
konnte ein politischer Witz das Todesurteil bedeuten. Unsere
‚Kampfmittel’ waren passive Resistenz gegenüber
den Forderungen der Nazis, selbst wenn die Karriere oder ein
sorgloses Leben gefährdet waren, und die antifaschistische
Aufklärung. (...) Allmählich lichteten sich unsere
Reihen. Der zunehmende Naziterror hatte auch in die Familien
einiger Jugendgenossen erbarmungslos eingegriffen. Sie blieben
aus Vorsicht fern. Andere fielen der Wehrmachts-Dienstpflicht
zum Opfer. Ich erinnere mich an den Abschiedsabend mit Herbert
– einem der beiden, die mich für die FAJ geworben
hatten.
Es kam keine rechte Stimmung auf. Und es war wie Hohn, als
wir zaghaft, mit gesenktem Blick eines unserer ‚Kampflieder’
anstimmten: "Nie woll’n wir Waffen tragen / nie
zieh’n wir in den Krieg!’“ (S. 89) Wer nicht
flüchtete und ins Exil ging, wollte wenigstens noch eine
Weile Sand ins Getriebe streuen. Die Wanderausflüge waren
noch möglich und auf einer Wanderung vereinigte sich
die FAJ mit der Reinickendorfer kommunistischen Parteijugend.
Die praktische Notwendigkeit, gegen die Nazis zusammenzuarbeiten,
führte zum Einheitsgedanken. Die KP-Strategie des „Trojanischen
Pferdes“, nazistische Organisationen wie etwa den Kleingärtner-„Heimatbund“
zu unterwandern, führte jedoch nur zu kleinen Erfolgen.
So gelang es Kurt, bei einem Laienspielabend dem Publikum
Verse von verbrannten Schriftstellern unterzujubeln.
Das Bündnis bekam Risse, als Rudolf Michaelis 1936-39
aus Barcelona Berichte über den Terror der StalinistInnen
1936 nach Berlin sandte. Und auch die Pressemeldungen über
die Schauprozesse in Moskau stellten die Jugendlichen aus
den zwei Lagern auf eine harte Probe, doch sie blieben zusammen.
Anfang April 1939 war es jedoch vorbei: Kurt wurde zum Reichsarbeitsdienst
eingezogen.
Weil er nur Dienst nach Vorschrift machte, sich nicht vordrängte,
beim Schießen nur Fahrkarten schoss und darauf achtete,
nicht Karriere zu machen, indem er immer wieder auf eine kleine
Sehbehinderung hinwies, blieb er im Arbeitsdienst („den
Spaten am Tornister, das Gewehr über der Schulter“),
als die Wehrmacht in Polen einfiel.
Hier schon erlebte er die Vertreibung der jüdischen Bevölkerung
durch die Wehrmacht, während er mit dem Spaten zerstörte
Straßen ausbesserte. Er kehrte im Oktober nach Berlin
zurück, doch nun gab es keine Schonzeit mehr. Es war
eine ständige, anstrengende Gratwanderung, nachdem er
im April 1940 zum Militär eingezogen wurde. Er schaffte
es, zum Innendienst zu kommen („Kartoffelschälen
für die Küche, Hilfsarbeiten für die Kleiderkammer,
Pferdegeschirre reinigen“). In dieser Funktion nahm
er am Überfall auf die Sowjetunion teil, in der Nachhut.
Das ständige Sich-Durchlavieren ermüdete den Einzelkämpfer.
So war er froh, als er mit drei anderen ehemaligen anarchistischen
Genossen zu einer Kartenrunde zusammenfand, die zwei Jahre
zusammenblieb und als Wachsoldaten für sowjetische Kriegsgefangene
diesen mitunter Nahrungsmittel zustecken konnte.
Die Gruppe sorgte für ein halbwegs anständiges Überleben
unter Tätern, sofern das überhaupt möglich
war:
„Als der LKW in die Stadt einfuhr, ließ der Leutnant
plötzlich halten und befahl uns, anzuschauen, was mit
‚bolschewistischen Verbrechern’ geschehen würde.
Und wir mussten sie uns dann ansehen, die Galgen mit den daran
baumelnden Toten – auf dem Platz vor dem Theater und
an einer Straßenecke.“
Mit seinem anarchistischen Freund Rudi Kuhn ging er nach der
„Räumung des Minsker Ghettos“, wo im November
1941 6-10.000 russische Juden und Jüdinnen liquidiert
worden waren, dorthin, um sich die Hölle mit eigenen
Augen anzusehen: Sie sahen eine Wüste, alles zerstört,
Hausrat, Scherben, Kleidungsstücke, Körperteile
Ermordeter, tote Säuglinge, an denen Ratten nagten. Rudi
sagte zu Kurt:
„’Weißt du, im Grunde sind wir auch schuldig
an all dem, was hier passiert ist... Wir helfen ja mit in
diesem Verein – du, weil du für die Landser Kartoffeln
schälst und sie mit neuen Klamotten versorgst und ich,
weil ich sie ausbessern helfe.’ Ich musste ihm beipflichten.“
(S. 119) Der aufrechte Gang war hier aussichtslos geworden.
Kurt wurde wie durch ein Wunder von seinem damaligen Arbeitgeber
Mitte 1943 gerettet, der meinte, dass Kurt daheim im Betrieb
„mehr fürs Vaterland“ tun könne denn
als „halber Soldat“ in der Etappe. Gegen Kriegsende
wurde Kurt noch ein Trupp jugendlicher Volkssturm-Eiferer
zugeteilt, doch er, der eigentlich Befehlshabende, ging einfach
nicht zum Einsatz und versteckte sich in Bunkern, bis die
Rotarmisten kamen. Er bekam mehrere Vergewaltigungen durch
die Rotarmisten mit. Trotz dieser schlimmen Erlebnisse sprach
Kurt rückblickend von einer „Befreiung“ vom
Nationalsozialismus.
Auseinandersetzungen mit der Literaturdoktrin
der DDR
Er hatte das Gefühl, jetzt beim Aufbau mitwirken zu müssen.
Von 1945 bis 1950 war Kurt Mitglied der KPD im sowjetischen
Sektor bzw. dann der DDR.
Bis zu seiner Pensionierung 1983 sollte er mehrmals den Beruf
wechseln. Er arbeitete anfangs sogar kurzzeitig als Polizist,
doch fast immer hatte seine Tätigkeit etwas mit Büchern
zu tun, ob als Bibliothekar, als Journalist oder als Korrektor
von literarischen Übersetzungen.
Schnell geriet er in Konflikt mit der rigiden Literaturdoktrin
des Marxismus-Leninismus.
Immer wieder wehrte er sich, so gut er konnte, gegen den stalinistischen
Kunst-Formalismus oder gegen den aufkommenden Nationalismus
und die Agitation gegen den so genannten bürgerlichen
„Kosmopolitismus“. Anlass für seinen Austritt
aus der SED 1950 war die Lektüre der Broschüre von
Rudolf Rocker: Der Leidensweg von Zenzl Mühsam über
deren Leidensweg in den stalinistischen Gefängnissen.
Erich von den Nazis ermordet, seine Frau Zenzl in der Sowjetunion
gequält, das war zu viel.
Solange die Mauer noch nicht gebaut war, hatte Kurt Kontakt
zu Fritz Linow und den alten GenossInnen um die Zeitschrift
Die freie Gesellschaft, für die er unter Pseudonym einige
Beiträge schrieb.
Nach dem Bau der Mauer arbeitete er lange für die DDR-Fernsehzeitung
„FF Dabei“. Das ständige Anecken, das ständige
Wechseln der Tätigkeit, das ständige Neuanfangen
ermüdete Kurt, der schließlich Kompromisse machte:
„Eine große Anzahl Artikel sind in diesen Jahren
(...) aus meiner Feder geflossen – Reportagen, Feuilletons,
Interviews, Meldungen und Glossen –, und es war schon
absonderlich, wenn sich in meinem Kopf der Streit zwischen
dem Zensor und dem Querdenker abspielte. Siegte der Querdenker,
bekam ich den Beitrag meist zurück und musste dann doch
dem Zensor das Feld überlassen.“ (S. 175)
Nach dem Fall der Mauer beteiligte sich Kurt kurze Zeit bei
der „Vereinigten Linken“ (VL), nahm am Hohenschönhausener
Runden Tisch teil und gab ein Jahr lang die „Oranke-Post“
heraus, die Teil einer Bewegung freier Zeitungen auf Bezirksebene
war, die bald erstarb und an die sich heute niemand mehr erinnert.
Die VL verließ er, als sich dort „Honeckerhörige
Altmarxisten und Jungfunktionäre der Stasi“ (S.
184) breit machten.
Er nahm Kontakt zur Umweltbibliothek, zur Freien-ArbeiterInnen-Union
und zur Graswurzelrevolution auf. Bei seinem Heidelberger
Redaktionsbesuch fiel mir neben seinem sympathischen Auftreten
sein fotographisches Gedächtnis auf.
Er konnte sich exakt an einen Schulausflug nach Heidelberg
erinnern, den er in den zwanziger Jahren mit seinem Gesangschor
gemacht hatte. Er sprach mit großer innerer Befriedigung
von seiner Aufgabe als Zeitzeuge für die Wehrmachtsausstellung
und den Diskussionen mit Ex-Landsern, die alles verdrängt
hatten. In den letzten Jahren seines Lebens reiste er viel,
um noch in hohem Alter die Welt zu sehen. Schließlich
ließ seine Sehkraft stark nach und er erblindete fast,
bevor er nun starb.
Rael
erschienen in der graswurzelrevolution
318 - April 2007
Seitenanfang
| Zurück
zur Startseite
|